 Das Olympieion in Athen
Das Olympieion in Athen
Die
korinthische Ordnung
ist eine der funf klassischen
Saulenordnungen
. In der Hierarchie der Saulenordnungen nimmt sie den Platz zwischen der
ionischen
und der
kompositen Ordnung
ein.
 Korinthische Saulenordnung
Korinthische Saulenordnung
Die klassische korinthische Ordnung ist wie folgt aufgebaut:
Fundament und
Sockel
eines Gebaudes korinthischer Ordnung bestehen aus dem
Stereobat
(Grundung) und der
Krepis
(Stufenunterbau). Das Fundament lagert hauptsachlich im Boden und ist nur an der geglatteten und halb freiliegenden obersten Schicht, der
Euthynterie
, sichtbar. Dem Fundament folgt die Krepis mit ihren drei Stufen. Die oberste Stufe wird als
Stylobat
bezeichnet und dient als Unterlage fur die aufstrebenden Saulen.
Auf kompositer oder
attischer Basis
mit
Plinthe
erhebt sich der
ionisch kannelierte Saulenschaft
mit 24
Kanneluren
. Die unteren Teile der Saulenschafte wurden bisweilen facettiert, gern wurden die Kanneluren im unteren Drittel auch mit sogenannten Pfeifenstaben gefullt. Der Schaft tragt das korinthische
Kapitell
. Den Kapitellkorper,
Kalathos
genannt, umgeben zwei versetzt angeordnete, unterschiedlich hohe Kranze aus je acht stilisierten
Akanthusblattern
. Aus den Eckblattern entwickeln sich sogenannte Caules, die jeweils zwei unterschiedlich stark gebildete Pflanzenstangel entlassen. Der kraftigere,
Volute
genannte Stangel wachst der Kapitellecke entgegen, wahrend der kleinere,
Helix
genannte Stangel sich zur Mitte der jeweiligen Ansichtsflache des Kapitellkorpers wendet. Die Voluten stutzen gleichsam die Deckplatte des Kapitells, den
Abakus
, dessen Seitenflachen konkav geschwungen sind. Eine Rosette oder Abakusblume ziert die Mitte jeder der vier Abakusseiten.
Das Gebalk ist aufgebaut aus Drei-
Faszien
-
Architrav
und glattem oder skulptiertem
Fries
. Nach einem Zwischenglied, das aus
Zahnschnitt
, einem
Wellenprofil
(
cyma reversa
) und
Eierstab
besteht, folgt das
Konsolengeison
, daruber eine
Sima
in Form eines
cyma recta
.
 Castortempel auf dem Forum Romanum
Castortempel auf dem Forum Romanum
 Rekonstruktion des Hafentempels der
Colonia Ulpia Traiana
(Xanten)
Rekonstruktion des Hafentempels der
Colonia Ulpia Traiana
(Xanten)
Die korinthische Ordnung ist der jungste der drei Baustile der
antiken griechischen Architektur
. Ihre Entwicklung begann in historischer Zeit gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. mit der ?Erfindung“ des korinthischen Kapitells. Ihr kanonischer Formenapparat, der aus der ursprunglich reinen Saulenordnung eine in sich geschlossene Bauordnung machte, lag verbindlich aber erst in der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. vor. Daher lassen sich die einzelnen Schritte ihrer Entwicklung gut verfolgen.
Das alteste erhaltene korinthische Kapitell ist an der Innenarchitektur des um 400 v. Chr. fertiggestellten
Apollontempels bei Bassae
nachzuweisen. Die Verwendung des korinthischen Kapitells beschrankte sich zunachst auf Innenraume (
Tholos von Delphi
,
Tholos von Epidauros
,
Tempel der Athena Alea in Tegea
) und Kleinarchitekturen (
Lysikratesmonument
? erstes Auftreten in der Außenarchitektur, Ptolemaion in
Samothrake
,
Mausoleum von Belevi
)
[1]
.
Die fruhen Beispiele korinthischer Saulen kombinierte man unter attischem Einfluss mit attischen Basen ohne Plinthe, mit ionischem Architrav in verschiedenen Ausformungen (zwei, drei Faszien oder glatt), mit ionischem Fries (glatt oder skulptiert) und ionischem Geison. Ab dem Lysikrates-Monument vermittelt als kanonisches Glied ein Zahnschnitt zwischen Fries und Geison.
Indem man die korinthische Saule in die Außenarchitektur ubertrug, befreite man sie zunachst von ihrer starren Bindung an ionische Gebalkformen. Haufig werden nun Kombinationen mit
dorischem
Gebalk, spiegeln aber zumeist landschaftliche Vorlieben wider. In Unteritalien treten auch Mischformen mit Terrakotta-Gebalken auf (Tempel B in
Pietrabbondante
[2]
).
Erst im ausgehenden 3. Jahrhundert v. Chr. findet das korinthische Kapitell seinen Weg in die monumentale Tempelarchitektur. Doch nachweislich und gut datiert tritt es erst zwischen 174 und 164 v. Chr. am
Olympieion
in Athen in der Außenarchitektur eines Tempels auf. Auch in die italische Tempelarchitektur findet es im 2. Jahrhundert v. Chr. Eingang,
[3]
wie etwa der korinthisch-dorische Forumstempel in
Paestum
zeigt.
[4]
Dieser Tempel belegt noch einmal die Eigenart des korinthischen Kapitells, je nach landschaftlicher Einbindung sowohl mit einem ionischen als auch mit einem dorischen Gebalk kombinierbar zu sein. Letztgenannte Variante begegnet sogar noch in augusteischer Zeit etwa am
Augustus-Tempel
von
Philai
in Agypten.
[5]
Selbst fur Vitruv (4,1,1-3) war die korinthische Ordnung immer noch eine reine Saulenordnung, die nach Belieben mit einem ionischen oder dorischen Gebalk verbunden werden konnte.
Dabei kam es bereits um 100/90 v. Chr. in Italien zur Verbindung der korinthischen Ordnung mit dem Konsolengeison als neuem kanonischen Element (Dioskurentempel in
Cora
[6]
). In der Folge setzt sich in Mittelitalien, insbesondere in Rom die
klassische
korinthische Ordnung durch, wie sie oben definiert wurde. Sie begegnet uns an fast allen stadtromischen Tempeln der
spaten Republik
und des fruhen
Prinzipats
wie dem
Apollotempel
in circo
oder dem
Mars-Ultor-Tempel
, aber auch in den romischen Provinzen wie an der
Maison Carree
in
Nimes
und vielen Bauten mehr. In ihrer Kombination attischer, kleinasiatischer und romisch-italischer Elemente ist die korinthische Ordnung eine der wichtigsten verbindenden Gestaltungsformen der romischen Reichsarchitektur.
Bis in die
Spatantike
bleibt die korinthische Ordnung in ihrer kanonischen Ausbildung erhalten. Mit der Wiederentdeckung antiker Architektur und der einsetzenden Vitruv-Rezeption in der
Renaissance
setzt auch die Wertschatzung der korinthischen Ordnung wieder ein, die korrekt nach dem Vorbild Vitruvs gestaltet wird. Bei Prachtbauten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein wurde die korinthische Ordnung eingesetzt.
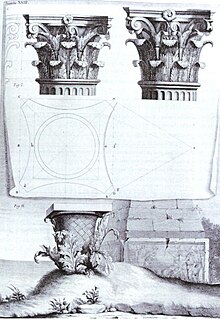 Erzahlung
Vitruvs
zum Ursprung der korinthischen Ordnung, illustriert in
Claude Perraults
Vitruvius
, 1684
Erzahlung
Vitruvs
zum Ursprung der korinthischen Ordnung, illustriert in
Claude Perraults
Vitruvius
, 1684
Vitruv
(4,1,9?10) uberliefert folgende Anekdote zur Entstehung des korinthischen Kapitells: Eine jungfrauliche
Korintherin
erkrankte und starb. Voller Trauer sammelte ihre alte Amme die Spielsachen, die die Verstorbene in ihrer Kindheit besonders geliebt hatte, in einen Korb und stellte diesen auf das Grab. Damit die Sachen unter freiem Himmel nicht so schnell zu Schaden kommen wurden, legt die Amme eine steinerne Platte zur Abdeckung auf den Korb. Der Korb stand aus Zufall uber einer Akanthuspflanze, deren Triebe an den Korbseiten emporwuchsen. Dies sah im Vorubergehen
Kallimachos
, ein Maler und Bildhauer aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., und ließ sich davon zum Schaffen des korinthischen Kapitell inspirieren.
Inwieweit diese Geschichte die Entstehung des korinthischen Kapitells als lokal-korinthisches Geschehen (
apud Corinthios
) reflektiert, ist nicht geklart. Eine weit verbreitete Interpretation fuhrt den Namen auf das Material, aus dem die ersten derartigen Kapitelle gefertigt worden sein sollen, zuruck:
korinthische Bronze
. Vor allem
Plinius
(
naturalis historia
34,13) wird herangezogen, um diese Herleitung zu stutzen. Plinius nennt die
porticus Octavia
in Rom
korinthische
wegen ihrer ?ehernen“ Kapitelle (
quae Corinthia sit appellata a capitulis aereis columnarum
). Doch wurde die
Porticus
Corinthia
wegen des Materials genannt, nicht aber wegen der Form ihrer Kapitelle. Philologische Hinweise sprechen fur eine geographische Herleitung des Namens, da bereits ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. im griechisch-hellenistischen Kulturraum die Kapitellform als
korinthiourges
bezeichnet wird.
[7]
Wortbildungen mit -
ourges
bezeichnen aber immer die lokale Herkunft einer Formgebung.
[8]
- Heinrich Bauer
:
Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr.
(=
Athenische Mitteilungen.
3. Beiheft). 1973.
- Pierre Gros
:
Aurea Templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome a l’epoque d’Auguste.
1976.
- Wolf-Dieter Heilmeyer
:
Korinthische Normalkapitelle
(=
Romische Mitteilungen
.
16. Erganzungsheft). 1970.
- Henner von Hesberg
:
Konsolengeisa des Hellenismus und der fruhen Kaiserzeit
(=
Romische Mitteilungen.
24. Erganzungsheft). 1980.
- Friedrich Rakob
, Wolf-Dieter Heilmeyer:
Der Rundtempel am Tiber in Rom.
1973.
- Frank Rumscheid
:
Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik.
Band I. 1994.
- Ralf Schenk:
Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus
(=
Internationale Archaologie.
Band 45). 1997,
ISBN 978-3-89646-317-3
.
- ↑
Zu korinthischen Kapitellen klassischer, fruhhellenistischer und romischer Zeit siehe etwa: Heinrich Bauer:
Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr.
(= 3. Beiheft Athener Mitteilungen). 1973; Friedrich Rakob, Wolf-Dieter Heilmeyer:
Der Rundtempel am Tiber in Rom.
1973, S. 23 ff.; Frank Rumscheid:
Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik.
Bd. 1, 1994, passim und besonders S. 309 f.; Wolf-Dieter Heilmeyer:
Korinthische Normalkapitelle
(=
Romische Mitteilungen.
16. Erganzungsheft). 1970.
- ↑
Maria Jose Strazzulla:
Il santuario sannitico di Pietrabbondante.
1973, S. 23 ff.
- ↑
Zu italisch-korinthischen Kapitellen siehe
Heide Lauter-Bufe
:
Die Geschichte des sikeliotisch-korinthischen Kapitells.
Zabern, Mainz 1987.
- ↑
Friedrich Kraus, Reinhard Herbig:
Der korinthisch-dorische Tempel am Forum von Paestum.
1939;
Emanuele Greco
, Dinu Theodorescu:
Poseidonia ? Paestum.
Band 3:
Forum Nord.
Ecole Francaise de Rome, Rom 1987, S. 30 ff.
- ↑
Heidi Hanlein-Schafer:
Veneratio Augusti.
Bretschneider, Rom 1985, S. 191 ff.
- ↑
Paola Brandizzi Vittucci:
Cora
(=
Forma Italiae
.
Regio I, Vol. V). De Luca, Rom 1968, S. 58 ff.
- ↑
Apollonios Rhodios frg. 1,7 P.
- ↑
Zur Diskussion der verschiedenen Standpunkte siehe Ralf Schenk:
Zur Bezeichnung Korinthisches Kapitell.
In:
Archaologischer Anzeiger
1996, S. 53?59.